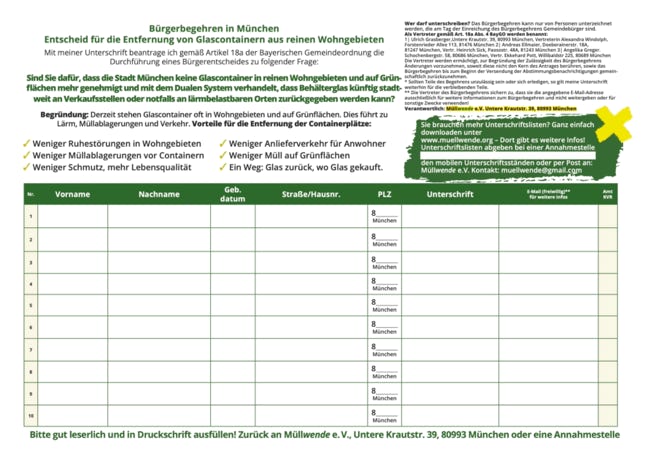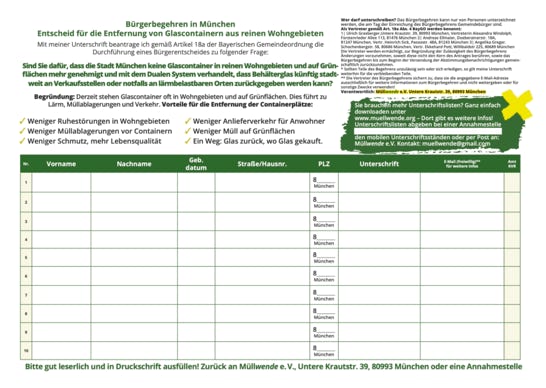Bürgerbegehren Glas. Weg mit den Containern


Bürgerbegehren Glas

Die Einführung des Holsystems und der Gelben Tonne bietet die Chance,
die Altglasentsorgung neu zu ordnen und die Containersammlung
in Wohngebieten und auf Grünflächen zu entfernen.
Auf diese Weise Glas im öffentlichen Raum zu sammeln, hat wenig Wirkung, aber gravierende Nebenwirkungen
Dem Müll einen Wert geben
Das bestehende Container-Bringsystem für Behälterglas oft in Wohngebieten und auf Grünflächen war vielleicht einmal ein pragmatischer Versuch, Wertstoffe zu trennen – seine negativen Begleiterscheinungen sind jedoch unübersehbar:
• Lärm und Ruhestörungen – zu jeder Tages- und Nachtzeit, ohne wirksame Sanktionierung.
• illegale Müllablagerungen – derzeit fallen rund 80 Tonnen Müll pro Monat an den Containerstandorten an. Solange es Container im öffentlichen Raum gibt, wird dort Müll abgeladen.
• soziale Verwerfungen – durch vermüllte Plätze, Sperrmüll, Ratten und Verunreinigungen in Wohngebieten
• geringe Sammelwirkung bei gleichzeitig hoher Belastung der Wohnumgebung
Die Zahlen sprechen für sich: In München werden über Glascontainer lediglich rund 17 kg Glas pro Einwohner und Jahr gesammelt. Gleichzeitig landen 16 kg im Restmüll – fast die gleiche Menge.
Hinzu kommen erhebliche Mengen, die in öffentlichen Abfallbehältern oder der Umwelt landen. Die Sammelwirkung ist somit gering – die Nebenwirkungen jedoch gravierend.
Glas ist zwar gut zu recyceln, aber nur wenn es gesammelt wird.
Wir fordern deshalb …
1. Keine neuen Glascontainer in reinen Wohngebieten und auf Grünflächen
Diese Standorte sind sozial und ökologisch besonders sensibel. Die Belastungen durch Lärm, Müll und Verkehr widersprechen jeder Idee von Wohn- und Lebensqualität.
2. Verhandlungen mit dem Dualen System über neue Rückgabestrukturen
Glas sollte dort zurückgegeben werden, wo es gekauft wird – an Supermärkten, Getränkemärkten, Kiosken oder Einkaufszentren. Auch eine Vereinfachung der Sammlung (z. B. Einfarbsystem) kann ein schrittweiser Einstieg in ein Glas-Holsystem sein.
3. Zusätzliche Standorte außerhalb sensibler Wohnlagen erschließen
Lärmverträgliche Plätze mit geeigneter Infrastruktur – etwa an Verkehrsachsen oder Gewerbestandorten – sollen genutzt oder neu ausgewiesen werden. Einige Glascontainer stehen bereits an solchen Orten und zeigen, dass die Nebenwirkungen der Containersammlung weniger spür- und sichtbar sind.
4. Keine blinde Verdichtung bestehender Containerstandorte
Die AWM-Parole, künftig mehr Glascontainer an bisherigen Standorten aufzustellen, führt in eine Sackgasse: Mehr Container am gleichen Platz bringen nicht automatisch mehr Glas, aber sicher mehr Unmut. Widerstand ist vorprogrammiert – ohne spürbare Verbesserung der Sammelquote.
5. Freiwerdende Flächen sinnvoll nutzen!
Auf ehemaligen Containerplätzen können Bäume gepflanzt, Flächen entsiegelt und Aufenthaltsbereiche geschaffen werden – ein Gewinn für das Mikroklima und die Stadtgesellschaft. Das wäre ein sichtbares Zeichen für einen Wandel in der Stadtentwicklung.
Eine nachhaltige Glasentsorgung braucht andere Konzepte
als mehr Container an überlasteten Plätzen
Die Sammlung von Haushaltsmüll im öffentlichen Raum hat sich als unkontrollierbar und sozial unverträglich erwiesen. Nicht die Menschen sind das Problem, sondern das System. Müll zieht Müll an. Lärm, Schmutz und Vandalismus sind die Folgen.
Wer die Lebensqualität in der Stadt steigern will, muss umsteuern – jetzt.